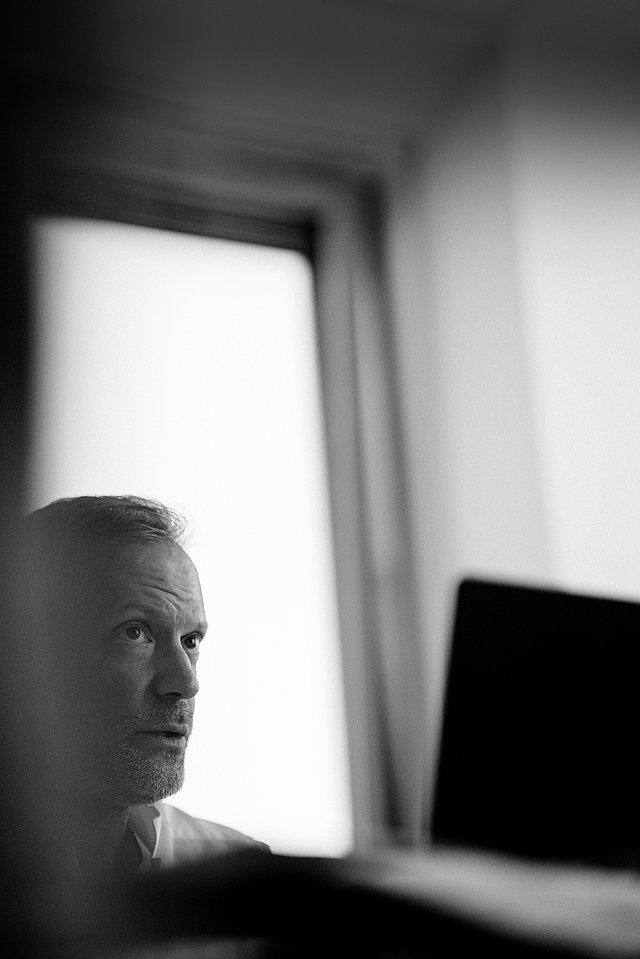Chris Roller (46) ist seit Januar Präsident des Ärzte- und Zahnärzteverbands AMMD. Er übernahm das Amt von Alain Schmit, der es zehn Jahre lang innehatte. Das Land traf ihn in seiner Praxis am Hôpital de Kirchberg.
d’Land: Herr Roller, für einige Aufmerksamkeit sorgten vergangene Woche Zahlen von Gesundheitsministerin Martine Deprez (CSV) zur Ärzte-Verteilung pro Kanton. Kantone wie Vianden und Wiltz sind anscheinend nicht gut versorgt, auch mit Generalisten nicht. Was meinen Sie dazu?
Chris Roller: Historisch war der Norden immer dünner besiedelt als Zentrum und Süden. Das wirkt sich aus. Die Zahlen der Ministerin sind aber auch ein Hinweis darauf, dass wir an der Ärzte-Demografie arbeiten müssen. Dass es wichtig ist, unseren Beruf attraktiv zu halten und ihn möglichst noch attraktiver zu machen, damit junge Menschen weiterhin Lust haben, ihn zu erlernen und auszuüben. Die AMMD weist darauf seit Jahren hin. Viele Kollegen gehören zur „Babyboomer-Generation“. Nicht wenige arbeiten weiter, obwohl sie schon in Pension sein könnten. Irgendwann werden sie in Pension gehen. Dann droht ein Problem, wenn nichts unternommen wird.
Wenn man konkret auf die Allgemeinmedizin schaut: 2024 gab es im Kanton Vianden vier Generalisten, im Kanton Wiltz 19. Landesweit wurden 778 Generalisten, 811 Zahnärzte und 1 952 Spezialisten gezählt. Besteht ein besonderer Mangel an Generalisten, die eine wichtige Rolle in der Primärversorgung zu spielen haben?
Der Norden ist ganz klar unterbesetzt. Das ist ein Problem. Es ist nicht einfach, gerade junge Leute zu motivieren, in ländliche Gegenden zu gehen. Ballungszentren sind beliebter, das trifft auch auf Ärzte zu. Die Primärversorgung ist in Luxemburg ein Stiefkind. Die Versorgung ist stark auf die Spitäler konzentriert, in den letzten 20 Jahren hat sich das noch verstärkt.
Was tun?
Wir haben schon oft gesagt: 80 Prozent der Medizin kann ambulant, außerhalb der Spitäler gemacht werden. Also müssen wir dezentralisieren. Schauen, dass Ärzte sich gemeinsam organisieren können, in den schon viel erwähnten Gesellschaften zum Beispiel. Um Gemeinschafts-
praxen einrichten zu können, die beispielsweise längere Öffnungszeiten bieten können. Das würde auch die Notaufnahmen der Spitäler entlasten.
CSV und DP hatten im Wahlkampf 2023 versprochen, „Freiheit für die Privatinitiative“ anstelle „sozialistischer Planwirtschaft“. Ich denke, das war im Sinne der AMMD…
… wobei Privatinitiative nicht Privatmedizin heißt.
Aber wie würden Privatinitiative und Dezentralisierung so gesteuert, dass sich in Gegenden mit wenig Ärzten die Versorgung verbessert? Wird das dem Markt überlassen, ändert sich vermutlich nicht viel. Braucht man nicht doch einen Plan, ein Instrument, damit vor allem Generalisten mit ihrer wichtigen Rolle sich auch in Gegenden niederlassen, die nicht so attraktiv sind?
Wenn man eine Arztpraxis eröffnet, gerade wenn man jung ist, muss man schauen, wo eine Nachfrage besteht. Wo nicht viele Menschen wohnen, wird man nicht viele Patienten finden. Das kann ein Problem sein. Dagegen gibt es keine Zauberformel. Wie ich schon sagte: Der Norden ist dünn besiedelt und historisch weniger gut versorgt. Im Osten ist das ähnlich.
Dort will das CHL nun eine „Antenne“ einrichten. Strukturell gesehen, hilft das wahrscheinlich.
Die Antenne soll nach Grevenmacher kommen. Das ist nicht gerade eine Gemeinde, wo fast niemand wohnt. Planwirtschaft in der Medizin ist in einem Land wie Luxemburg keine gute Idee. Die CNS hat rund eine Million Versicherte. Mindestens ein Drittel sind frontaliers, die hier ihre Beiträge zahlen und ein Recht darauf haben, hier behandelt zu werden. In den Gemeinden jenseits der Grenze, wo sie wohnen, finden sie vielleicht keine Ärzte, keine Krankenpfleger mehr, weil wir alle zu uns gezogen haben. Wir haben also eine Verantwortung. Die Planwirtschaft hat die Spitäler groß gemacht und zu viel an Versorgung bei ihnen konzentriert. Dadurch sind sie heute ein bisschen der Flaschenhals. Deshalb sagen wir, es muss dezentralisiert werden. Und ja, wir müssen das dem Markt überlassen. Das wird dazu führen, dass die Wartezeiten für viele Behandlungen deutlich sinken.
Wo sind die Wartezeiten besonders lang?
Ganz besonders lang sind sie für Darmspiegelungen. Da wartet ein Patient mehr als ein Jahr. Einen Termin für eine IRM-Untersuchung zu bekommen, dauert ebenfalls noch lange. Es gibt zwar mittlerweile mehr Apparate. In den Spitälern sind sie für ambulante Patienten bis spätabends im Einsatz und auch am Wochenende. Trotzdem sagen mir Patienten noch immer regelmäßig: Ich wende mich ins Ausland, dort geht es schneller. Hinzu kommt, dass IRM-Analysen immer mehr zum Standard vieler Behandlungen werden. Sie stehen in europäischen Leitlinien, die einzuhalten aber ein Problem sein kann. Deshalb sagt die AMMD: Es kann nicht angehen, das Angebot bei uns künstlich knapp zu halten. Wenden Patienten sich ins Ausland, finanzieren wir die Strukturen dort mit, aber wieso tun wir das? Wir müssen das ehrlich diskutieren. Es heißt immer, wir wollen keine Zwei-Klassen-Medizin, aber de facto haben wir eine, wenn es noch immer so ist, dass ins Ausland geht, wer sich das leisten kann.
Aber wer zum Beispiel nach Trier geht für eine IRM-Untersuchung, bezahlt dort als Privatpatient. Wenn unser öffentliches System öffentlich finanziert bleiben soll, kann es nicht mit der deutschen Privatmedizin konkurrieren. Deutsche Kassenpatienten müssen auch lange auf IRM-Termine warten. Sodass wohl immer jemand, der sich das leisten kann, in Trier schneller drankommt.
Ich meine, in Deutschland müssen nicht nur Privatversicherte weniger lange warten als Patienten in Luxemburg, sondern deutsche Kassenpatienten auch. Und es geht nicht nur um IRM. Unser System ist relativ strikt. Ein Arzt kann nur anbieten, was in der Gebührenordnung steht, der „Nomenklatur“. Über sie hinaus ist kein Behandlungsvertrag möglich. Ich als Urologe zum Beispiel kann bestimmte innovative Operationen nicht anbieten, weil die Nomenklatur dafür keinen Tarif enthält. Dann kann es sein, dass ein Patient sagt: Ich versuche es im Ausland, stellen Sie mir bitte das entsprechende Formular aus. Ich schreibe das Formular, er wird im Ausland behandelt und bekommt das von der CNS erstattet. Warum können wir das nicht hier machen? In Deutschland kann es sein, dass eine Krankenkasse sagt: Ganz innovative Behandlungen übernehmen wir nicht, wir zahlen nur für die gängigen Prozeduren. Doch dann hat der Patient die Möglichkeit, die innovative Behandlung zu bekommen, wenn er zuzahlt. In Luxemburg kann der Arzt sie nicht mal anbieten.
CNS und AMMD hatten 2014 abgemacht, die Nomenklatur Kapitel für Kapitel zu reformieren, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Facharztgesellschaften. Das dauert also zu lange?
Dass vor elf Jahren damit begonnen wurde und noch einige Kapitel offenstehen, deutet schon darauf hin, dass es lange dauert. Aber was reformiert wurde, muss man aktuell halten, das ist ein ständiger Prozess. Einen neuen Tarif einzuführen, dauert mindestens ein Jahr. Natürlich dient die Nomenklatur dazu, einen gewissen Rahmen zu setzen, auch für die Kostenentwicklung der Krankenversicherung. Das ist in Ordnung. Aber der medizinische Fortschritt geht rasant voran.
Also wird es nach Auffassung der AMMD ohne Zuzahlungen nicht gehen?
Nein, nicht unbedingt. Aber außerhalb der Nomenklatur kann ein Arzt, wie gesagt, keinen Behandlungsvertrag anbieten. Das würde ich schon ändern: Wer etwas in seine Gesundheit investieren will, sollte es auch in Luxemburg tun können. Im Moment geht das nicht. Die CNS fragt uns, wenn es um neue Methoden geht: Was habt ihr bisher in Rechnung gestellt?, und empfiehlt dann vielleicht: Nehmt diesen oder jenen Tarif. Aber so eine Abrechnung „per Analogie“ ist eigentlich nicht mehr erlaubt. Sie sehen: Im Alltag ist alles nicht so einfach. Und es fehlt die ehrliche Diskussion darüber.
Nach dem Regierungswechsel hielt die AMMD sich mit politischen Äußerungen lange zurück. Im Mai beklagte sie, wie die Diskussion über das drohende Milliardenloch in der Krankenversicherung geführt wird. Im Juli ging sie OGBL und LCGB scharf an wegen des Krankenhaus-Kollektivvertrags. Wieso ausgerechnet die beiden Gewerkschaften? Die AMMD ist auch eine Gewerkschaft, Dokteschgewerkschaft nennt der Volksmund sie oft.
Eine regelrechte Gewerkschaft sind wir nicht. Die AMMD repräsentiert die Ärzte und Zahnärzte. Sie trägt dafür Sorge, dass in der Medizin die Arbeitsbedingungen gut sind, und hat auch das Patientenwohl im Auge. Vor über 100 Jahren wurde sie gegründet…
… 1904 als Syndicat Médical.
Aber wir sind eher ein Berufsverband. OGBL und LCGB unterliegen einem Interessenkonflikt, wie wir das sehen. Seit 2019 wird festgestellt, dass der CNS allmählich das Geld ausgeht, es wurde aber nichts unternommen. Wir müssen laut Gesetz alle zwei Jahre unsere Tarife mit der CNS neu verhandeln. Dabei gibt es normalerweise gewissen Spielraum. In den letzten Verhandlungen aber wurde uns gesagt: Ihr müsst sparen, sparen, sparen, sonst wird das nichts. Und: Wenn ihr viel spart, können wir euch vielleicht etwas geben. Deshalb schlugen die Verhandlungen fehl und wir sind jetzt im Schlichtungsverfahren. Aber dann machen während dieser Schlichtungsverhandlungen OGBL, LCGB und der Krankenhausverband FHL eine gemeinsame Pressemitteilung und sagen, sie hätten den Kollektivvertrag für das Spitalpersonal verlängert, mit rückwirkenden Prämien für 2023 und 2024 und einer Gehaltserhöhung ab Januar 2025. Was nicht nur für das Pflegepersonal gilt, sondern für das gesamte Spitalpersonal von Sekretärinnen über Informatiker bis hin zum Pflegepersonal. Uns Ärzten sagt die CNS, es sei kein Geld da. Wir wurden in Sitzungen mit dem CNS-Verwaltungsrat eingeladen, die kurzfristig abgesagt wurden, weil CA-Mitglieder andere wichtige Termine hatten. Uns nimmt man nicht für voll, obwohl wir doch wichtige Akteure im Gesundheitswesen sind. Es ist für uns wichtig, zu sagen, dass da ein Interessenkonflikt besteht. Im Verwaltungsrat der CNS sitzen Vertreter derselben Gewerkschaften, die für die Spitäler Kollektivverträge mit Erhöhungen verhandeln.
Seit der DP-LSAP-Koalition der Siebzigerjahre vollzieht der Spital-Kollektivvertrag die Gehälterentwicklung im öffentlichen Dienst nach. Es gibt eine paritätische Kommission aus Gewerkschaften und FHL, die berät, wie das geschehen soll. Das Ergebnis fließt in die enveloppe budgétaire globale für sämtliche Spitäler ein, die alle zwei Jahre vom Regierungsrat beschlossen wird. Der Einfluss von OGBL und LCGB hat Grenzen.
Deshalb sagt Ministerin Martine Deprez, unser Protest sei nicht ehrlich. Es handle sich um keine Gehaltserhöhung, weil alles schon budgetiert ist. Aber man kann doch nicht behaupten, weil etwas budgetiert ist, sei es keine zusätzliche Ausgabe für die CNS. Die enveloppe budgétaire globale ist eine komplizierte Sache, da geht es um Milliarden. Es sind öffentliche Gelder, von uns allen, die Gewerkschaften in der CNS mit anvertraut werden zum bestmöglichen Einsatz für die Gesundheit.
Hat der Unmut der AMMD vor allem damit zu tun, dass mit dem Kollektivvertrag der Spitalsektor etwas erhält, während die AMMD den secteur extrahospitalier besonders entwickeln möchte, den es noch nicht wirklich gibt?
Der Spitalsektor wird favorisiert, ganz klar.
Andererseits ist Pflegepersonal ähnlich knapp wie Ärzte, manche sagen, noch knapper. Da in Luxemburg zu wenig ausgebildet wird, tragen hohe Gehälter dazu bei, dass Pflegeberufler aus dem Ausland kommen.
Das bestreiten wir nicht. Aber gerade wenn Knappheit herrscht, können wir die Spitäler nicht immer größer machen. Es wäre wichtig, mal zu ermitteln, an welchen Posten von Spitalpersonal, die für Arbeit am Patienten bezahlt werden, tatsächlich Arbeit am Patienten geleistet wird. Ich kann Ihnen sagen, auch in meinem Spital gibt es viele, die nicht mehr so richtig in dem Beruf arbeiten wollen, der auch anstrengend ist. Sie werden dann vielleicht auf einen Posten mit Verantwortung umgesetzt oder sonst einen, auf dem sie nicht mehr in der Patientenversorgung tätig sind. Das kann es auch nicht sein. Deshalb sagen wir, wenn Knappheit herrscht in Spitälern, die große Strukturen sind, in denen Patienten sich mitunter verlaufen, wo auch Krankenpfleger sagen, das ist mir zu groß, zu anonym, dann würden kleinere Strukturen den Patienten etwas bringen und dem Personal auch.
Sind die AMMD-Mitglieder je nach Fachrichtung unterschiedlich sensibel gegenüber Gehaltserhöhungen für das Klinikpersonal? Laut Sécu-Jahresbericht der IGSS sind die Unterschiede in der von den Ärzten eingenommenen Honorarmasse je nach Spezialisierung enorm. Ganz oben die Radiologie, ganz unten die Allgemeinmedizin und die Endokrinologie, bei einer Differenz um fast den Faktor vier im Jahr 2023.
Apparatemedizin war schon immer höher bewertet als die, wo der Arzt mehr mit dem Patienten spricht. Angehende Ärzte wissen, ehe sie ihre Spezialausbildung aufnehmen, wie die Honorierung je nach Fachgebiet aussieht. Ich denke, dass jeder das in seine Entscheidung für eine bestimmte Richtung einbezieht. Man muss auch bedenken, dass Radiologen viel Zeit im Spital verbringen und viele Untersuchungen an Patienten aus der Notaufnahme vornehmen. Also nehmen sie entsprechend viel Honorar ein. Für andere Fachrichtungen sind die Belastungen während der Bereitschaftsdienste weniger groß, die Einnahmen auch.
Wird die AMMD durch ihre Mitglieder damit konfrontiert, für Ausgleich zwischen den Fachrichtungen zu sorgen?
Alle Ärzte über einen Kamm zu scheren, geht nicht. Aber wir sind bemüht, selektive Aufwertungen vorzunehmen. In Tarifverhandlungen mit der CNS besteht dazu die Möglichkeit. Sofern die Deadline für den Abschluss der Verhandlungen nicht überschritten wird wie diesmal, als die CNS uns ziemlich kurzfristig mitteilte, dass sie an den Ärzten sparen will.
Apropos Dezentralisierung: Sollen die künftigen Centres médicaux ganz für sich funktionieren oder sollen die dortigen Ärzte auch einen Vertrag mit Spitälern haben?
Für uns wichtig, dass die Ärzte sich selber organisieren können. Insofern sollen die Zentren für sich sein. Vernetzung und Austausch mit den Spitälern aber muss es geben. Kann ja sein, dass ein Patient in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden muss.
Sollten die Ärzte der Zentren einen Vertrag mit einem Spital haben?
Die Überlegung kann man anstellen. Für Ärzte, die das möchten, sollte das möglich sein, wenn jemand es nicht will, ebenso.
Aber dann könnte der schon bestehende Ärztemangel sich noch verschärfen.
Berechtigte Frage. Zumal wir nicht einfach Ärzte haben wollen, sondern gute, um eine gute Medizin machen zu können. Dazu müssen die Bedingungen stimmen. Je nach Spezialisierungsrichtung ist man sowieso am Spital. Neurochirurgie oder Reanimation wird man nicht an einem Centre médical praktizieren. Es wird immer Ärzte geben, die lieber große Behandlungen vornehmen und lieber an einem Krankenhaus arbeiten, und jene, denen eher ein Praxiszentrum liegt. Ich denke nicht, dass plötzlich kein Arzt mehr an einem Krankenhaus wird arbeiten wollen. Im Ausland funktioniert die Versorgung mit Krankenhäusern einerseits und andererseits Strukturen außerhalb der Kliniken auch.
Die Politik sagt dazu bisher nichts, oder? Trotz des eigentlich guten Drahts, den die AMMD zu Ministerin Martine Deprez hat.
Martine Deprez hat uns zugehört. Beim Regierungswechsel waren wir optimistisch, weil CSV und DP versprochen hatten, ambulante Strukturen zu verbessern. Aber vor anderthalb Jahren zog Martine Deprez den Gesetzentwurf ihrer Vorgängerin über die Gesellschaften, die wir für so wichtig halten, ziemlich sang- und klanglos zurück. Ich bin seit Januar AMMD-Präsident, ich traf die Ministerin Anfang des Jahres. Sie sagte, bis Jahresende werde sie einen neuen Text vorlegen, im Gesetzentwurf von Paulette Lenert gebe es Unstimmigkeiten. Aber Ende des Jahres werden zwei Jahre der Legislaturperiode verstrichen sein, und wir wissen nicht, was in dem neuen Text stehen soll.
Die AMMD wurde nicht dazu konsultiert?
Bisher nicht. Deshalb fragen wir uns, ob in der Legislaturperiode genügend Zeit bleiben wird. Wenn ein neuer Gesetzentwurf auf den Instanzenweg geschickt wird, ist er ja noch lange nicht durch.
Wieso sind die Gesellschaften so wichtig? Bisher können Ärzte Assoziationen bilden. Auch Immobiliengesellschaften, um gemeinsam Praxisräume zu kaufen, dafür einen Kredit aufzunehmen. Warum reicht das nicht?
In den Zentren soll mehr angeboten werden, als die bisher möglichen Zusammenschlüsse erlauben. In Gesellschaften kann man sich größer zusammenschließen. Nicht zu vergessen: Ein Arzt haftet im Moment mit seinem persönlichen Vermögen. Das ist ein großes Risiko, in einer Gesellschaft kann man sich besser absichern. Und eine Gesellschaft kann Ärzte einstellen – Kollegen, die selber kein Cabinet finanzieren wollen, sich nicht selber um Personal kümmern möchten und vielleicht nur halbtags arbeiten wollen.
Die AMMD hat im Juli auch geschrieben, „eng kloer Begrenzung vun der Zuel vun de Zänndokteren ass néideg“. Warum soll die Privatinitiative in diesem Punkt eingeschränkt werden?
Wir haben mehr Zahnärzte als Generalisten. Grund dafür ist unter anderem: Viele Zahnärzte aus Drittstaaten lassen ihr Diplom in Frankreich anerkennen. Ehe sie im konventionierten Sektor Frankreichs arbeiten dürfen, müssen sie mindestens drei Jahre Tätigkeit in einem anderen EU-Land nachweisen. In Luxemburg wird jeder Arzt und jeder Zahnarzt automatisch und obligatorisch mit der CNS konventioniert a ka sech direkt hei am Buttéck zervéieren. Ein paar schlaue Finanziers, zum Beispiel aus Paris, schließen mit solchen Zahnärzten Verträge in Luxemburg ab. Was für Verträge das genau sind, wissen wir nicht. Die Zahnärzte werden für drei Jahre hier angestellt. Das sind diese Zentren, die 24/7 geöffnet sind, auch sonntags, und in denen Patienten mitunter Rechnungen über 600 oder 700 Euro erhalten. Zwar gibt es eine Gebührenordnung der Zahnärzte, aber die CNS weiß nicht genau, wie sie funktioniert, und hat teilweise Leistungen erstattet, die sie eigentlich nicht hätte erstatten dürfen. Darauf haben Zahnärzte, die ehrliche Arbeit machen, hingewiesen.
Wie könnte das Problem gelöst werden?
Letztendlich ist das eine politische Frage. Sie stellt sich seit Jahren, aber die Politik geht da nicht ran.
Wenn Gesellschaften eingeführt werden, kommen wahrscheinlich noch mehr schlaue Finanziers.
Wenn wir sagen, Privatinitiative, schwebt uns nicht vor, dass sich Finanziers hier niederlassen und Ärzte einstellen. Wir wollen, dass die Mehrheit an den Gesellschaften bei den Ärzten liegt…
… was Finanziers nicht ganz ausschließt?
An sich wollen wir, dass Ärzte sich zusammentun. Je nachdem, was für ein Zentrum man aufbauen will, könnte es sein, dass man einen Partner mit besonderem Knowhow braucht, der vielleicht Startkapital mitbringt. Die Mehrheit der Anteile aber sollte bei den Ärzten liegen. Das kann man per Gesetz vorschreiben. Und ich denke, dass viele Zentren Kapital von außen gar nicht brauchen werden. Vorausgesetzt, die außerklinische Medizin wird gerecht bezahlt und nicht gegenüber den Spitälern benachteiligt.
Paulette Lenerts Gesetzentwurf wollte die Gesellschaftsanteile auf Personen „aus dem Beruf“ beschränken. Für ausländische Gesellschaften sollte das nicht gelten, Paulette Lenert sagte damals, die Freiheit der Kapitalzirkulation in der EU erfordere das.
Das kann ich juristisch nicht genau beantworten. Aber die Vorschriften für Anwaltskanzleien zum Beispiel schließen aus, dass Akteure, die nicht Anwälte sind, von außen reinkommen können. Da klappt das, also denke ich, dass man auch Finanziers nur in Minderheitenposition für medizinische Gesellschaften gesetzlich vorschreiben kann. Zumal das Gesetz schon jetzt viel einschränkt. Zum Beispiel, dass IRM-Analysen nur in Spitälern oder Antennen gemacht werden können.